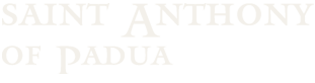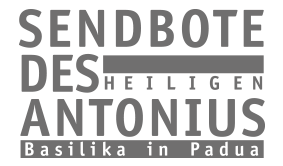Das außergewöhnliche Leben des hl. Franziskus
Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein zu einem Besuch der Restaurierungsarbeiten in der Bardi-Kapelle in der Basilika Santa Croce in Florenz. Die Fresken, ein Meisterwerk Giottos, erzählen in sechs Szenen das Leben des hl. Franziskus von Assisi.
Unter den Brüdern, die anlässlich des Kapitels von Arles versammelt sind, suche ich natürlich als erstes den hl. Antonius. Und ich finde ihn sofort, an der Seite stehend. Er hat begriffen, dass sich etwas Wunderbares ereignet: Der hl. Franziskus ist erschienen, eben in dem Moment, als er gerade zu den Brüdern predigt. Seine Arme sind erhoben und zeigen in den Himmel. Nun scheint es, dass er sich genau an Antonius wendet, der ihn mit Gelassenheit beobachtet. Die anderen Brüder sitzen und nur ein paar von ihnen machen den Eindruck, als hätten sie die Erscheinung bemerkt.
Giotto hatte dieses Wunder bereits um das Jahr 1295 herum malerisch erzählt, als er mit 28 Szenen das Leben des hl. Franziskus in seinem berühmten Fresken-Zyklus in der Basilika in Assisi dargestellt hat. 20 Jahre später möchte die reiche Bankiersfamilie Bardi aus Florenz, dass Giotto mit denselben Szenen ihre kostbare kleine Familienkapelle neben dem Hauptaltar in der Basilika Santa Croce in Florenz freskiert. Giotto ist da schon über 50 Jahre alt, also nicht mehr der junge Künstler, der so mutig war, die Basilika in Assisi zu gestalten – sein Ruhm ist gefestigt, er ist bekannt und hat eine eigene Werkstatt, wo viele junge Männer für ihn arbeiten. Florenz ist seine Stadt: Er nimmt den Auftrag der Bardis an und vertieft sich zum zweiten Mal in das Leben des heiligen Franziskus. Santa Croce ist kein beliebiger Ort, hier war der Heilige aus Assisi schon 1211 gewesen, hier hatten die Franziskaner bereits auf sumpfigem Gelände eine kleine Kapelle, die dem Heiligen Kreuz geweiht war, errichtet, die im Laufe der Zeit zu einer wundervollen Basilika mit Konvent geworden ist.
Auf Tuchfühlung mit den Restauratorinnen
Es ist eine glückliche Dankbarkeit, die ich verspüre, als ich das Gerüst heraufklettere, wo die Restauratorinnen des Opificio delle Pietre Dure arbeiten, die den Auftrag haben, den ursprünglichen Glanz der Fresken von Giotto wiederherzustellen. Und dort bin ich dem Blick des hl. Antonius begegnet, der hier so ganz anders dargestellt ist als in der klassischen Ikonografie. Ich hatte das Glück zu diesem privilegierten Einblick, denn bis Juli 2025 ist es am Wochenende je maximal fünf Personen möglich, die Restaurierungsarbeiten zu besichtigen und die Fresken, die in sechs Szenen das Leben des Franziskus darstellen.
Maria Rosa Lanfranchi, Restauratorin und Konservatorin am Opificio delle Pietre Dure, einer angesehenen florentinischen Restaurierungswerkstatt, hat einen starken Charakter, und sobald sie anfängt, über diese Fresken zu sprechen, kommt ihre ganze Leidenschaft zum Vorschein. Es gelingt ihr, mit den Pigmenten, mit dem Blau des Himmels von Giotto, mit dem weißen Kalk in einen Dialog zu treten, und sie kann uns übersetzen, was die Steine, die Pulver, die Farben mit ihrer stummen Sprache zu sagen haben. Ihre Empfehlungen klingen eher wie Befehle: „Schreibt nicht, dass wir die Geheimnisse Giottos ergründet haben: Wir haben nur gelernt, ihn besser zu verstehen. Schreibt nicht, dass die Fresken ihren ursprünglichen Glanz wiedererhalten haben, wir möchten nur dazu beitragen, dass ihre Schönheit, die sie bis heute erhalten haben, bewundert werden kann!“ Mittlerweile dauern diese Restaurierungsarbeiten schon 15 Jahre. Dank der Unterstützung der Getty Foundation aus Los Angeles konnte im Jahr 2010 mit der langen und komplexen „Voruntersuchung“ begonnen werden, bei der innovative fotografische Techniken zum Einsatz kamen, mit denen der Zustand der Fresken untersucht wurde. Darauf folgten Jahre der theoretischen Vorbereitung und Forschung, die auch durch die Pandemie verlangsamt wurden, bis dann im September 2022 die Arbeit vor Ort begonnen wurde – 70 Jahre nach der letzten Restaurierung.
Ein jeweils anderer Umgang mit dem historischen Erbe
Die sieben Jahrhunderte der „Lebensgeschichte“ dieser Fresken (allerdings wurde ein wichtiger Teil „trocken“ aufgetragen, also nicht in der für Fresken typischen Arbeitsweise, bei der die Pigmente auf den frischen [frisch = fresco] Kalkputz aufgetragen werden) sind ein Abenteuer; alleine die letzten zwei Jahrhunderte waren gekennzeichnet von einer langen Geschichte von Restaurierungen. Der Ruhm Giottos erfuhr in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Art Einbruch: Das Desinteresse für diese Meisterwerke führte dazu, dass die Wände der Bardi-Kapelle mit Kalk weiß übertüncht wurden. Die Leuchtkraft der Fresken wurde von einem weißen Schleier verdeckt und sie gerieten in Vergessenheit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden sogar zwei monumentale Kenotaphe, also Ehrengrabmäler, für zwei großherzogliche Architekten an den Wänden angebracht. Mitte des 19. Jahrhunderts hat man sich dann für eine neue Gestaltung der Kapelle entschieden, die Grabmäler wurden wieder beseitigt und dabei kamen Fragmente der Fresken aus dem 14. Jahrhundert zum Vorschein.
Die damalige Restaurierung wurde Gaetano Bianchi anvertraut, einem bekannten Florentiner Restaurator. Die Kratzer, Abschürfungen, alle diese kleinen „Verletzungen“ der Fresken, die man heute noch sieht, entstanden bei der mühseligen Arbeit, bei der im Jahr 1852 der Kalkputz abgetragen wurde. Zu jener Zeit wurden beschädigte Kunstwerke wieder hergestellt, leere Stellen und verloren gegangene Teile wurden ersetzt. Man versuchte, sich vorzustellen, wie die Gemälde ursprünglich ausgesehen hatten. Im 19. Jahrhundert wurde von den Restaurateuren versucht, alle Mängel und Defekte auszugleichen oder zu verstecken. Heute geht man mit einem ganz anderen Ansatz an solche Restaurierungsarbeiten: Die Eingriffe müssen deutlich sichtbar sein, aber seit Gaetano Bianchis Zeit muss noch ein Jahrhundert vergehen. Im 20. Jahrhundert kehrt sich die Philosophie der Restaurierung um: Das zeitgenössische Werk muss hervorgehoben werden, der Besucher wird nicht mehr getäuscht, es wird nicht mehr versteckt, die Wahrheit muss bekannt sein.
Wenn Farben wieder sprechen
Die neuen Arbeiten an den Fresken in der Bardi-Kapelle, die zwischen 1957 und 1958 stattfanden, wurden vom Superintendenten, dem großen Kunsthistoriker Ugo Procacci, in Auftrag gegeben und Leonetto Tintori anvertraut, einem außergewöhnlichen Restaurator aus Prato, der in seiner Jugend als Köhler und Spinner gearbeitet hatte, um sein Kunststudium zu finanzieren. Ihm verdanken wir die Wiederherstellung von Giottos „großem Licht der Authentizität“. Tintori entfernte alle „Übermalungen“ aus dem 19. Jahrhundert, entdeckte die Risse in den Fresken und machte die fehlenden Teile sichtbar: „Nur das, was von dem ursprünglichen Gemälde übrig blieb, durfte sprechen.“ Heute gehen die zeitgenössischen Restauratoren denselben Weg, indem sie das intensive Blau von Giottos Himmel wiederentdecken und das Licht der Gelb-, Rot- und Grüntöne durchscheinen lassen. Es ist die Farbpalette des Künstlers, die Farben wurden alle aus natürlichen Pigmenten hergestellt. Unsere Augen suchen nach Details, werden von den Hintergründen, den Gesten der Menschen und ihrer Mimik angezogen: Diese Fresken waren in der Lage, zu den Bardi, den superreichen Bankiers, und den ungebildeten Bauern auf dem florentinischen Land zu sprechen. Und fast acht Jahrhunderte später erzählen sie auch uns etwas über Schönheit und Erlösung.
Franziskus-Biografie mit Details
Noch bis Juli 2025 ist es, wie gesagt, mit einer Vorreservierung möglich, den Fresken in der Bardi-Kapelle sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen: eine einzigartige Chance, wobei die Tickets allerdings längst schon alle ausgebucht sind.
Wie in Assisi sind auch hier die Chroniken des Bonaventura da Bagnoregio, einem Minderbruder, Kardinal, Theologen, Philosophen und eben Franziskus-Biographen, die Quelle für die Erzählung des Lebens des hl. Franziskus. Wenn die Restaurierungen abgeschlossen sein werden, kann der Besucher im Zentrum der Kapelle die sechs Szenen aus dem Leben des hl. Franziskus bewundern. Zu lesen sind sie von links nach rechts und von oben nach unten. Da ist also der Verzicht auf den Reichtum des Vaters: Franziskus‘ Vater verbirgt seinen Zorn hinsichtlich der Entscheidung seines Sohnes nicht, die Kinder, die Steine nach ihm werfen, werden an den Haaren gezogen und man sieht, dass sie schreien. In der Lünette sieht man die einzige Frau, die Giotto in diesem Freskenzyklus gemalt hat. Ich muss lächeln, denn um mich herum sind es fast nur Frauen in ihren weißen Arbeitskitteln, die an den Fresken arbeiten. Eine junge Frau hat sich in den zwei Stunden meines Besuchs fast nicht von der Stelle gerührt: In einer mir sehr unbequem erscheinenden Position berührte sie mit einem feinen Pinselchen ganz leicht die Wand, um eine fast unmerkliche Linie nachzuzeichnen – der Beruf der Restauratorin erfordert viel kräftezehrende Geduld.
In der zweiten Szene hört Papst Innozenz III., der wie ein Herrscher gekleidet ist, das Gebet des Franziskus und seiner Brüder, die vor ihm knien, in ihren einfachen Kutten. Gezeigt wird hier die Bestätigung ihrer Ordensregel. Weiter oben erscheint Franziskus beim Kapitel in Arles, auf einem anderen Bild sehen wir ihn, wie er sich unter den Augen von Sultan al-Malik al-Kaˉmil der Feuerprobe stellt. Weiter unten knien die bestürzten Brüder um den Leichnam von Franziskus: Die Engel tragen bereits die Seele des Heiligen in den Himmel. Der Arzt Hieronymus berührt, immer noch ungläubig, die Stigmata. Die letzte Szene ist die „lückenhafteste“: In der Mitte einer fast kreisförmigen Leere erscheinen, wie von einem Heiligenschein umgeben, einige Brüder, die der Erzählung eines ihrer Brüder, Bruder Augustinus, lauschen, der gerade gesehen hat, wie die Seele von Franziskus in den Himmel aufgestiegen ist. In der gleichen Szene erscheint der Heilige dem Bischof von Assisi im Traum: „Siehe, ich verlasse die Welt und gehe in den Himmel“.