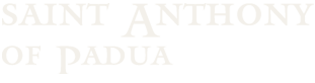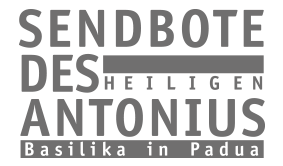Wenn Märchen vom Leben erzählen
Er hat dem Kaiser neue Kleider angezogen, die Prinzessin auf die Erbse gelegt und der brütenden Entenmutter ein Schwanen-Ei untergejubelt: Der dänische Autor Hans Christian Andersen ist weltberühmt für seine Märchen. Anlässlich seines 150. Todestages am 4. August blicken wir auf sein Leben und Werk.
Ein verarmter Schuhmacher und eine alkoholkranke Wäscherin: Es sind wohl nicht die besten Voraussetzungen, in die Hans Christian Andersen am 2. April 1805 in Odense, einer Stadt auf der dänischen Insel Fünen, hineingeboren wird. Seine Kindheit ist von großer Armut geprägt, jedenfalls materieller Armut. Denn an Fantasie und Kreativität ist man – notgedrungen – reich. Die Mutter hat religiöse Tiefe, aber wohl einen ähnlich ausgeprägten Aberglauben mit den merkwürdigsten Vorstellungen. Und der Vater? Der vermittelt dem Sohn die Liebe zu Geschichten, wenn er ihm regelmäßig aus „1001 Nacht“ vorliest. Da verwundert es kaum, dass sich der kleine Hans Christian lieber mit Theater und Puppenspiel beschäftigt als mit dem regelmäßigen Schulbesuch.
Im Auf und Ab des Lebens
Ein tragischer Einschnitt ist der frühe Tod des Vaters. Hans Christian ist gerade einmal elf Jahre alt. Mit 14 zieht es ihn nach Kopenhagen. Dort versucht er, seiner künstlerischen Ader nachzugehen: Am Theater wird er zwar als Schauspieler nicht genommen, und auch seine Versuche als Sänger sind nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Doch er veröffentlicht erste Gedichte und besucht schließlich doch dank der Unterstützung eines Gönners und nach Abschluss der schulischen Grundausbildung die Universität in der dänischen Hauptstadt.
Privat ist ihm kein Glück beschieden. 1830 verliebt er sich in Riborg Voigt, die Schwester eines Studienfreunds. Doch die ist bereits einem anderen Mann versprochen und macht keine Anstalten, Andersens Gefühle zu erwidern. Wie sehr ihn diese Ablehnung traf, lässt sich daran erkennen, dass er Riborgs Abschiedsbrief zeitlebens aufbewahrt hat: Nach seinem Tod wurde er samt einer Locke ihres Haares in einem kleinen Ledersäckchen gefunden. Immer wieder wird er sich zwar verlieben, doch romantische Beziehungen, geschweige denn feste Partnerschaften oder gar eine Ehe werden nie daraus.
Mit ganz eigenem Stil
Im Lauf seines literarischen Schaffens wird er insgesamt 156 Märchen veröffentlichen und gilt als Revolutionär des Märchengenres – nicht nur durch seine Themenwahl, sondern vor allem durch seine stilistische und emotionale (biografisch gut nachvollziehbare) Tiefe. Während traditionelle Volksmärchen häufig anonym überliefert und moralisch klar kodiert waren, verleiht Andersen seinen Erzählungen eine individuelle Handschrift: Seine Märchen sind persönlich, poetisch und oft von melancholischer Schönheit durchzogen. Viele seiner Figuren sind Außenseiter, die gegen die Konventionen ihrer Umwelt ankämpfen – verletzliche Wesen mit Träumen und Ängsten. Das vielleicht bekannteste Beispiel dafür ist Das hässliche Entlein, eine Parabel auf Andersens eigenes Leben, das immer wieder von Ablehnung und Ausgrenzung geprägt war: „Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte; es war so betrübt, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhofe verspottet wurde.“ Mit diesem Märchen thematisiert er nicht nur Selbstfindung und Transformation, sondern auch die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, ein Motiv, das universelle Gültigkeit besitzt.
Auch stilistisch betritt Andersen neue Wege. Er schreibt in einer schlichten, beinahe mündlichen Sprache, die sich deutlich von der hochgestochenen Literatur seiner Zeit abhebt. Seine Märchen sind nicht nur lesbar, sondern hörbar – sie laden dazu ein, erzählt zu werden. Oft arbeitet er mit Rhythmus, Wiederholungen und melodischem Sprachfluss.
Der dänische Autor ist zudem ein Meister des Symbolismus. Gegenstände, Tiere und Naturphänomene sind bei ihm nicht bloße Kulissen, sondern Träger tieferer Bedeutung. Die Nachtigall wird zur Stimme des wahren Gefühls, die Schneekönigin zur Verkörperung emotionaler Kälte. Gleichzeitig spiegeln seine Märchen gesellschaftliche Realitäten: den Druck zur Anpassung, das Machtspiel der Eliten, die Härte sozialer Ungleichheit – alles verpackt in scheinbar einfachen Geschichten. Damit schafft er Texte, die Kinder intuitiv erfassen können und Erwachsene nicht unterfordern. Diese Sprachbalance und sein Verarbeiten existenzieller Themen tragen bis heute wesentlich zur weltweiten Popularität seiner Werke bei, auch wenn er sich bisweilen dagegen wehrte, vor allem als Autor von Märchen für Kinder gesehen zu werden. Dennoch: Der Welttag des Kinderbuches findet, zu seinen Ehren, jährlich am 2. April, seinem Geburtstag, statt.
Internationale Anerkennung
Zahlreiche Reisen führen ihn nach England, Italien, Spanien oder Portugal und immer wieder nach Deutschland. Über 30 Mal war er in Dresden. In den 1830-er Jahren findet der junge Dichter in Deutschland sogar größere Anerkennung als in seinem eigenen Heimatland. Übersetzt werden nicht nur seine Märchen, sondern auch sein erster Roman Der Improvisator, außerdem Novellen, Dramen und Reiseberichte.
Siebzigjährig und international anerkannt und verehrt stirbt Hans Christian Andersen am 4. August 1875 in Kopenhagen. Etwas anekdotenhaft mutet es an, wenn überliefert ist, dass er eine fast zwanghafte Angst vor Krankheit und insbesondere dem Tod hatte: Er reiste stets mit einem Zettel, auf dem stand: „Ich bin nicht tot“, falls man ihn bewusstlos für tot halten sollte… Literarisch ist er lebendig geblieben – bis heute.