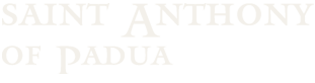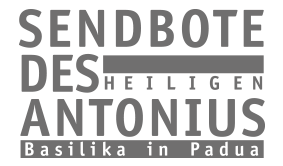China in Afrika
Es geht um Geld und Investitionen, um Rohstoffe und Wirtschaftsgüter – aber auch um den Traum von einer besseren Zukunft. Unser Thema des Monats blickt nach Afrika und nimmt die chinesischen Aktivitäten auf diesem oft so vernachlässigten und ausgebeuteten Kontinent unter die Lupe.
Was China und Afrika betrifft, bringt es das Kieler Institut für Weltwirtschaft auf den Punkt: „Seit der Jahrtausendwende hat China im Rahmen seiner ‚going out‘-Politik sein Engagement in Afrika stark ausgebaut. Dies ist auf dem gesamten afrikanischen Kontinent sichtbar und gilt für bilaterale Handelsbeziehungen, Auslandsinvestitionen, Entwicklungshilfe und die Einwanderung chinesischer Arbeitskräfte.“
Das im Jahr 2000 gegründete Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), welches sich der chinesisch-afrikanischen Zusammenarbeit verpflichtet fühlt, ist ein äußeres Zeichen der intensivierten Beziehungen zwischen der Volksrepublik und dem afrikanischen Kontinent. Das letzte Gipfeltreffen fand im September 2024 in Peking statt. Für die nächsten drei Jahre sagte Chinas Staatspräsident Xi Jinping Finanzhilfen von über 45 Milliarden Euro zu, mehr als die Hälfte davon in Form von Krediten.
Chinas globale Investitionsstrategie
Der größere Hintergrund ist Chinas Investitionsoffensive, die unter dem Stichwort Neue Seidenstraße bzw. Belt and Road Initiative bekannt ist. Seit dem Jahr 2013 investiert China massiv in den Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastruktur-Netze zwischen der Volksrepublik und 100 anderen Ländern auf der ganzen Welt. Das Projekt knüpft an die alten Handelsrouten an, die China einst mit dem Westen verbanden: Marco Polos Seidenstraße im Norden und die maritimen Expeditionsrouten des Admirals Zheng He im Süden. Gebaut werden neben Stromnetzen und Straßen auch Eisenbahnlinien, Flug- und Seehäfen sowie ganze Industrieparks – häufig realisiert von chinesischen Baufirmen, die ihre Arbeiter zu Hunderttausenden auf den afrikanischen Kontinent bringen. Mehr als 1.000 Brücken, fast 100 Häfen und 10.000 Kilometer Bahnstrecke hat China in den vergangenen 25 Jahren in Afrika gebaut, so zählt es Xu Jianping von der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform auf.
Zwischen Chance und Risiko
Viele afrikanische Länder sehen in der Neuen Seidenstraße eine seltene Chance, lang vernachlässigte Infrastrukturprojekte umzusetzen. Im Gegensatz zu westlicher Entwicklungshilfe verlangt China keine demokratischen Reformen oder gute Regierungsführung als Voraussetzung für Investitionen. Die Chinesen haben vielmehr den Ruf, schnell und effizient Bauprojekte voranzutreiben – wenn auch häufig zu Lasten von Umwelt- und Sozialstandards.
Die 728 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba und dem nächstgelegenen Hafen im ostafrikanischen Dschibuti wurde mit chinesischer Hilfe errichtet. 2011/2012 wurden die Aufträge des drei Milliarden Euro teuren Projekts vergeben und im Oktober 2015 waren bereits 87% der Arbeiten abgeschlossen. Der planmäßige Verkehr auf der voll elektrifizierten Strecke wurde im Januar 2018 aufgenommen. Das Flaggschiffprojekt der chinesisch-afrikanischen Zusammenarbeit zeigt bei allen Vorteilen aber auch die Schattenseiten auf. Äthiopien wird noch auf viele Jahre hin mit der Rückzahlung der Schuldenlast kämpfen: Die Kredite chinesischer Banken müssen regelmäßig bedient werden. Die Auslastung der Bahn liegt unter den kalkulierten Erwartungen. Die Einnahmen fallen geringer aus als vermutet, die laufenden Kosten sind hoch. Dass beim Bau fast ausschließlich chinesische Firmen beteiligt waren, hat der lokalen Wirtschaft nicht den so dringend benötigten Aufschub verliehen – und man wird dauerhaft auf China angewiesen bleiben: Technologietransfer und lokale Kompetenzentwicklung blieben hinter den Erwartungen zurück.
In den Augen von Kritikern ist die Neue Seidenstraße deshalb kein Projekt der Kooperation und der gleichberechtigten Zusammenarbeit, sondern ein Vorhaben, das vor allem wirtschaftlichen und geopolitischen Zielen Chinas diene. Einerseits will China eigene Überkapazitäten verringern, indem neue Exportmärkte geschaffen werden, andererseits will man sich Zugang zu wertvollen Rohstoffen sichern. Der eigene Vorteil steht oft im Fokus.
Hilfe aus der Krise
Das vermag ein weiteres Paradebeispiel zu illustrieren: die Beziehungen zwischen China und Angola. Nach dem Ende des jahrzehntelangen Bürgerkriegs im Jahr 2002 stand Angola vor der gewaltigen Aufgabe, das Land wiederaufzubauen. In dieser Phase trat China als zentraler Partner auf den Plan und entwickelte mit Angola ein Geschäftsmodell, das später in vielen afrikanischen Staaten Schule machte: Kredite gegen Rohstoffe.
China gewährte Angola Milliardenkredite – vor allem über die staatliche Bank of China (Exim-Bank) – die vorrangig für den Wiederaufbau der Infrastruktur verwendet wurden. Finanziert wurden damit unter anderem der Bau von Straßen, Eisenbahnen, Krankenhäusern und Wohnsiedlungen. Im Gegenzug erhielt China langfristige Lieferverträge für angolanisches Erdöl, das zur Rückzahlung der Kredite diente. Angola entwickelte sich so zeitweise zum zweitwichtigsten Öllieferanten Chinas nach Saudi-Arabien.
Dieses Modell wurde als pragmatische Win-win-Situation dargestellt: Angola bekam Zugang zu dringend benötigten Finanzmitteln ohne die oft an politische Reformen geknüpften Bedingungen westlicher Geber, und China sicherte sich den Zugang zu wichtigen Rohstoffen. Gleichzeitig ist das Abkommen nicht unumstritten. Kritiker bemängeln die mangelnde Transparenz der Verträge, die starke Abhängigkeit Angolas von Ölpreisschwankungen sowie die Tatsache, dass viele der Infrastrukturprojekte von chinesischen Firmen mit chinesischen Arbeitskräften durchgeführt wurden – was nur begrenzt zu lokaler Beschäftigung führte.
Trotz dieser Kritikpunkte hat das Modell maßgeblich zur schnellen Verbesserung der angolanischen Infrastruktur beigetragen. Heute jedoch steht Angola vor der Herausforderung, seine Wirtschaft zu diversifizieren und sich aus der einseitigen Abhängigkeit vom Erdöl – und von China – zu lösen. Die Kooperation mit China bleibt zwar wichtig, doch zunehmend sucht das Land nach einem nachhaltigeren Entwicklungsmodell.
Mitten in der Schuldenfalle
Wohin eine solche „Kooperation“ führen kann, zeigt Sambias Staatsbankrott im November 2020: Im Zuge der Covid-19-Pandemie konnte die ehemalige englische Kolonie ihre Kreditraten bei den Gläubigern nicht mehr bedienen. Der im August 2021 neu gewählte Präsident Hakainde Hichilema gab an, eine leere Staatskasse vorgefunden zu haben. Die Verschuldung wurde auf 115 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beziffert. Zum Vergleich: Die Konvergenzkriterien verlangen für die Mitgliedsländer der Europäischen Union eine Schuldenquote von maximal 60 % des BIP.
Nach ebenso langwierigen wie zähen Verhandlungen gelang es, eine Umstrukturierung eines Teils der Schulden zu vereinbaren. China, einer der großen Kreditgeber Sambias, war dabei besonders zögerlich.
In der Folge wurde dem Reich der Mitte immer wieder der Vorwurf der Debt-trap diplomacy gemacht: Einem Schuldnerland werden Kredite gewährt, und wenn diese dann nicht mehr bedient werden können, versucht der Kreditgeber, seinen politischen Einfluss stark zu erhöhen. Weil die Bedingungen derartiger Kreditgeschäfte häufig nicht öffentlich sind, kann der Gläubiger seine Position ausnutzen, um wirtschaftliche oder politische Zugeständnisse zu erlangen, wenn das Schuldnerland seinen Rückzahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.
Allerdings: „China nur als Bösewicht in Afrika zu sehen, ist definitiv nicht im Interesse von irgendjemandem, zumindest nicht im Interesse von Afrika“, so Jana de Kluiver, Institute für Security Studies in Pretoria, Südafrika.
Geprägt von Eigeninteressen
Denn ist das westliche Engagement automatisch nachhaltiger? Im Vergleich zum chinesischen Engagement verfolgt der Westen in Afrika eine grundsätzlich andere Strategie. Institutionen wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds oder die Europäische Union verbinden ihre Finanzhilfen und Investitionen häufig mit politischen Auflagen – etwa der Einhaltung demokratischer Prinzipien, guter Regierungsführung und menschenrechtlicher Standards. Auch hier gibt es also Eigeninteressen. Die westliche Entwicklungszusammenarbeit setzt aber stark auf langfristige Projekte zur Stärkung von Bildung, Gesundheit, Verwaltungsstrukturen oder zivilgesellschaftlicher Teilhabe. Dieser Ansatz zielt auf nachhaltige Entwicklung, ist jedoch oft mit langwierigen Antragsverfahren, Abstimmungen und bürokratischen Hürden verbunden. – Da mag eine rasch gebaute Straße, die sofort genutzt werden kann, als Investitionsprojekt verlockender erscheinen. Der chinesische Ansatz, der öffentlichkeitswirksam auf realisierte Infrastrukturprojekte verweisen kann, verändert dann auch westliche Zugänge zur Hilfe in Afrika: „Machen wir es nicht, macht es China“, ist in politischen Debatten zu den EU-Afrika-Beziehungen immer häufiger zu hören.
Weltpolitische Folgen
Damit wird auch deutlich: Chinas Engagement in Afrika ist längst mehr als nur ein wirtschaftliches Investitionsprogramm, das auf einen Kontinent beschränkt ist – es hat eine deutliche geopolitische Komponente. Mit seiner wachsenden Präsenz in Afrika sichert sich China nicht nur den Zugang zu Rohstoffen und neuen Absatzmärkten, sondern auch politische Unterstützung auf internationaler Bühne. In Institutionen wie den Vereinten Nationen, dem Internationalen Währungsfonds oder dem Menschenrechtsrat profitiert die Volksrepublik zunehmend von der wachsenden Zahl afrikanischer Staaten, die als verlässliche Verbündete auftreten – nicht selten im Austausch für wirtschaftliche Hilfe, Schuldenrestrukturierung oder Infrastrukturprojekte.
Besonders in Abstimmungen der UN-Generalversammlung oder bei der Besetzung internationaler Posten zeigt sich Chinas wachsender Einfluss. So unterstützten mehrere afrikanische Staaten wiederholt chinesische Positionen etwa zur Taiwan-Frage oder zur Politik rund um die autonome Region Xinjiang, der Heimat der Uiguren – Themen, in denen westliche Staaten kritische Töne anschlagen.
Wahlfreiheit und Abhängigkeiten
Gleichzeitig ist Chinas Engagement auch Ausdruck eines globalen Machtkampfs: Im geopolitischen Wettbewerb mit den USA und der EU geht es längst nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern um strategische Positionierung im globalen Süden. Während westliche Staaten versuchen, durch neue Afrika-Strategien ihren Einfluss zurückzugewinnen – etwa durch das G7-Programm Partnership for Global Infrastructure and Investment –, bleibt Chinas Vorsprung in vielen Regionen spürbar.
Für viele afrikanische Länder eröffnet diese Konkurrenz kurzfristig neue Spielräume: Sie können zwischen den Partnern wählen und Bedingungen ausbalancieren. Doch langfristig besteht die Gefahr neuer einseitiger Abhängigkeiten, diesmal nicht vom Westen, sondern von Peking. Besonders kritisch sehen Beobachter, dass China nicht nur wirtschaftliche, sondern zunehmend auch sicherheitspolitische Strukturen aufbaut – etwa durch den ersten chinesischen Militärstützpunkt in Dschibuti oder die Ausbildung afrikanischer Sicherheitskräfte durch chinesisches Personal. Die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit wird so auch zu einem Faktor der globalen Sicherheitsarchitektur – mit offenem Ausgang.
Als Menschen einander verpflichtet
Immer, wenn Länder zum Spielball anderer Interessen zu werden drohen oder wenn Regierungen von Nationen nicht wirklich die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger im Blick haben, gilt es wachsam zu sein. Der Kirche, die in ihrer eigenen Missionsgeschichte leider oft genug wenig sensibel und bisweilen sogar brutal vorgegangen ist, kann dabei eine besondere Verantwortung zukommen. Sie weiß sich der Seite der Armen und Bedrängten verpflichtet. In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium mahnt Papst Franziskus eindringlich: „Manchmal geht es darum, den Schrei ganzer Völker, der ärmsten Völker der Erde zu hören, denn der Friede gründet sich nicht nur auf die Achtung der Menschenrechte, sondern auch auf die Achtung der Rechte der Völker.“ Es muss „doch immer wieder daran erinnert werden, dass der Planet der ganzen Menschheit gehört und für die ganze Menschheit da ist und dass allein die Tatsache, an einem Ort mit weniger Ressourcen oder einer niedrigeren Entwicklungsstufe geboren zu sein, nicht rechtfertigt, dass einige Menschen weniger würdevoll leben. Es muss noch einmal gesagt werden: Die am meisten Begünstigten müssen auf einige ihrer Rechte verzichten, um mit größerer Freigiebigkeit ihre Güter in den Dienst der anderen zu stellen.“ (EG 190)