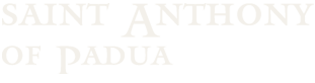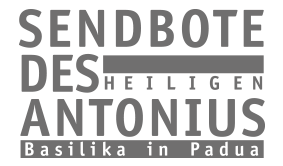Einsamkeit als neue Volkskrankheit?
Auch wenn Einsamkeit oft tabuisiert wird und man selten offen darüber spricht: Für viele Menschen ist das Alleinsein zunehmend ein Problem. In unserer Sommerausgabe werfen wir einen Blick auf dieses Thema – und bieten hoffentlich auch die ein oder andere Anregung.
Ein fröhlicher Abend. Lieschen Müller, die man seit dem Tod ihres Mannes vor etlichen Jahren kaum mehr hat lachen sehen, hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Ein Schwank aus der Jugend, ein herzhafter Witz, eine peinliche Geschichte über sich selbst, eine lustige Anekdote über den Bürgermeister und den Pfarrer: Ein ums andere Mal hat sie die Unterhaltung der geselligen Runde fast im Alleingang geschmissen. Was für eine Glanzstunde unter Freunden! Als sie sich schließlich verabschiedet, ist sie von einem Schlag auf den anderen ganz nachdenklich. Man sieht es ihr im Gesicht sofort an. Und schließlich traut sie sich auch: „Danke für den schönen Abend. Aber jetzt werde ich gleich in meiner Wohnung sein. Die ist leer. Mein Mann ist tot. Es gibt keine Freude mehr im Haus. Die Kinder kommen nur selten. Die Enkel sind weit weg. Und ich weiß jetzt schon: Wenn ich die Wohnungstüre hinter mir zugezogen haben, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin, dann werden mir sofort die Tränen kommen. Die Einsamkeit, sie ist so furchtbar!“ Die fröhliche Runde, die eben noch herzhaft gelacht hat, hat dafür kein Rezept und im Augenblick auch gar keine Antwort. Alle fühlen mit. Keiner kann wirklich helfen. Einsamkeit hat viele Gesichter und ist oft gerade da, wo man sie kaum vermutet.
Statistisch erfasste Einsamkeit
Diese geschilderte Situation mag einem nachvollziehbar erscheinen, vielleicht auch bekannt vorkommen, möglicherweise sogar aus dem eigenen Leben. Statistisch betrachtet ist Lieschen Müller jedoch nicht das repräsentativste Beispiel, denn: Einsamkeit trifft deutlich mehr die jüngeren Menschen. Der „Einsamkeitsreport 2024“ der Techniker-Krankenkasse stellt fest: „Einsamkeit kommt besonders häufig bei unter 40-Jährigen vor: 68 Prozent dieser Altersgruppe geben an, sich häufig, manchmal oder selten einsam zu fühlen. Bei älteren Menschen sind es mit gut 50 Prozent deutlich weniger. Vergleicht man jene, die Einsamkeit häufig oder manchmal empfinden, so ist deren Anteil bei den unter 40-Jährigen fast doppelt so hoch wie bei den über 60-Jährigen (22 Prozent gegenüber zwölf Prozent).“ Auch wenn vier von zehn Befragten angegeben haben, nie einsam zu sein: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland kennt das Gefühl der Einsamkeit.
Das Schweizer Bundesamt für Statistik stellt fest: „Zwischen 2017 und 2022 ist der Anteil der Personen, die über ein Gefühl der Einsamkeit berichten, in allen Bevölkerungsgruppen signifikant gestiegen.“ Das statistisch erfasste „Einsamkeitsgefühl“ ist nach wie vor hoch, auch wenn zu berücksichtigen ist, dass im Statistikzeitraum die Corona-Pandemie für zusätzliche soziale Härten gesorgt hat. Was die statische Erhebung der Einsamkeit betrifft, kommt im deutschen Sprachraum nur Österreich besser weg: Die erste EU-weite Erhebung zum Thema, „The EU Loneliness Survey“ vom November/Dezember 2022 zählt Österreich zu den fünf Ländern mit der niedrigsten Einsamkeitsrate: Sie liegt unter zehn Prozent.
Wenn man allerdings bedenkt, dass solche Statistiken unterschiedlich angelegt sind und anders gelagerte Fragestellungen und Methoden auch zu abweichenden Ergebnissen führen, sind sie sicherlich mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Faktum bleibt: Einsamkeit ist etwas, das viele Menschen betrifft.
Warum Menschen einsam werden
Einsamkeit entsteht, wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass seine sozialen Beziehungen nicht ausreichend seien. Dass die deutsche Bundesregierung seit Juni 2022 eine „Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit“ erarbeitet, um Einsamkeit vorzubeugen und zu lindern, mag zeigen, dass es sich beim notvoll empfundenen Alleinsein um ernstzunehmende Gefühle handelt.
Betroffen sind Menschen aus allen Lebensphasen und Gesellschaftsgruppen. Besonders gefährdet sind Menschen in Übergangsphasen des Lebens: beim Eintritt in Studium, Ausbildung oder Beruf, beim Umzug in eine neue Stadt, nach dem Tod eines nahestehenden Menschen oder beim Übergang in den Ruhestand. In solchen Situationen können gewohnte Netzwerke wegbrechen – und neue Bindungen lassen sich oft nicht sofort aufbauen. Ein erhöhtes Risiko, einsam zu werden, haben auch Menschen, die gesellschaftlich oder strukturell benachteiligt sind: Alleinlebende, Alleinerziehende, pflegende Angehörige, Menschen mit Migrationsgeschichte, gesundheitlichen Einschränkungen, eingeschränkter Mobilität, geringem Einkommen oder niedrigem Bildungsstand. Oft fehlt es ihnen an Zugang zu Gemeinschaft, an Ressourcen oder an gesellschaftlicher Teilhabe – Faktoren, die Einsamkeit begünstigen können.
Alleinsein als Belastung
Einsamkeit ist dabei aber mehr als nur ein unangenehmes Gefühl. Wer sich dauerhaft allein fühlt, setzt nicht nur seine seelische Gesundheit aufs Spiel – auch Körper und soziale Beziehungen können erheblich darunter leiden. Die Forschung zeigt: Einsamkeit ist ein ernstzunehmender Risikofaktor, der vergleichbare Auswirkungen haben kann wie Rauchen oder Übergewicht.
Einsamkeit schlägt auf die Psyche. Besonders häufig sind depressive Verstimmungen oder Angstsymptome. Menschen, die sich sozial isoliert fühlen, empfinden häufig starken inneren Stress – ein Gefühl, das der Körper ähnlich verarbeitet wie physischen Schmerz. Auch das Selbstwertgefühl leidet: Betroffene neigen dazu, sich selbst abzuwerten und das eigene Leben negativ zu bewerten. Hinzu kommt: Chronische Einsamkeit erhöht das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen bis hin zu Demenz. Der seelische Rückzug kann somit auch mentale Funktionen langfristig schwächen.
Auch der Körper bleibt von der Einsamkeit nicht verschont. Studien wie die renommierte Heinz-Nixdorf-Recall-Studie belegen einen klaren Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall treten bei einsamen Menschen häufiger auf. Der Grund: Anhaltender Stress beeinflusst die Ausschüttung von Hormonen wie Cortisol, was das Immunsystem schwächt und den Körper anfälliger für Krankheiten macht. Schlafprobleme sind ebenfalls weit verbreitet – viele Einsame schlafen schlechter und weniger erholsam.
Und obendrein: Wer sich einsam fühlt, zieht sich oft noch weiter zurück. Der soziale Rückzug verstärkt das Gefühl der Isolation – ein Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in andere, soziale Fähigkeiten nehmen ab. Gespräche fallen schwerer, Unsicherheit wächst und der Zugang zu neuen Kontakten bleibt versperrt.
Lieber in den Knast?
Besonders dramatisch zeigen sich die Auswirkungen der Einsamkeit in Japan. Dort hat man mit dem Begriff „Hikikomori“ ein eigenes Wort für das Phänomen von Menschen, die zutiefst einsam sind und sich komplett aus dem Sozialleben zurückziehen. Eine Studie geht davon aus, dass mehr als eine Million Menschen in Japan das Haus kaum mehr verlässt – Einsamkeit in einer ganz extremen Ausprägung! Die Politik versucht, dieser um sich greifenden Not gegenzusteuern. Seit 2021 gibt es in Japan ein eigenes Einsamkeitsministerium. Per Gesetz sind seit vergangenem Jahr alle regionalen Behörden verpflichtet, Räte und Selbsthilfegruppen einzurichten, um Betroffene zu unterstützen. Professionelle Berater/innen sollen einsamen Menschen helfen.
Wohin Einsamkeit – häufig gepaart mit Armut – im Extremfall führen kann, zeigt das Frauengefängnis von Tochigi. „Lieber im Gefängnis als verarmt im Pflegeheim“, hat eine Insassin im CNN-Interview festgestellt. Einsamkeit, hohe Miet- und Lebenshaltungskosten veranlassen eine nicht unerhebliche Zahl älterer Frauen, absichtlich kleinere Straftaten zu begehen. Wer genug Ladendiebstähle begangen hat, wird schließlich eingesperrt. Das Leben im Knast ist einfach, häufig ist es kalt, es gibt nur wenig Essen und die Wärter sind streng. Dennoch sehen viele ältere Frauen das Gefängnis als ihr neues Zuhause. Und die Justizbeamten? Die stellen etwas frustriert fest: „Wir müssen Windeln wechseln und beim Baden helfen.“ Das Gefängnis ähnelt einem Pflegeheim…
Im Netz und trotzdem einsam
In der digitalen Welt, in der eher die jüngeren Menschen unterwegs sind, hat sich eine neue Form des Alleinseins etabliert: die digitale Einsamkeit. Auf den ersten Blick wirkt alles verbunden. Messenger-Nachrichten, Likes, Kommentare, Videocalls – die Mittel der Kommunikation sind allgegenwärtig, die Wege zueinander theoretisch kurz. Und doch erleben gerade viele junge Menschen eine paradoxe Leere: stundenlang online, doch ohne echte Nähe. Die sozialen Netzwerke versprechen Gemeinschaft, aber liefern oft nur Oberfläche. Wer nicht mithält, nicht ständig postet, reagiert und liked, verschwindet schnell im digitalen Off. Und wer zu tief in die digitalen Welten eintaucht, fühlt sich leicht ausgeschlossen: abgehängt vom Leben der anderen, das so mühelos, erfolgreich und glücklich wirkt. „FOMO“, die Angst, etwas zu verpassen, ist dabei nur ein Teil des Problems. Was Vielen fehlt, ist etwas ganz anderes: wirklicher Kontakt. Ein echtes Gespräch, in dem Pausen erlaubt sind. Ein Treffen ohne Filter. Ein Blick, der länger dauert als drei Sekunden.
Die Forschung zeigt, dass intensive Nutzung sozialer Medien mit höherem Einsamkeitsempfinden korrelieren kann – besonders dann, wenn sie echten Austausch „von Mensch zu Mensch“ ersetzt. Zwar können digitale Kanäle ein wertvoller Anker sein, besonders für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder in ländlichen Regionen. Aber sie stoßen schnell an Grenzen: Wenn Begegnung nur noch über Bildschirme läuft, wenn Kommunikation vor allem inszeniert ist, dann bleibt vieles ungesagt – und ungefühlt. So bringt das Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit eine neue Herausforderung mit sich: Einsamkeit inmitten digitaler Dauerkommunikation. Es ist ein leises, oft unbemerktes Alleinsein – und genau deshalb so schwer zu durchbrechen.
Eine ganze Reihe von Initiativen
Eine eigene „Angebotslandkarte“ mit Suchfunktion rund um den eigenen Wohnort, die vom „Kompetenznetz Einsamkeit“ (www.kompetenznetz-einsamkeit.de) aktuell gehalten wird, will Auswege anbieten. Und Ideen, um der Einsamkeit vorzubeugen und dem Alleinsein zu begegnen, gibt es viele. Mehrgenerationenhäuser bieten Angebote für alle Altersgruppen. Gerade in größeren Städten bleibt dabei kaum ein Themenwunsch unerfüllt. In der Schweiz gibt es ein lebendiges Netzwerk an „Erzählcafés“ (www.netzwerk-erzaehlcafe.ch). Moderierte Gesprächsrunden zu Themen wie Erfolgserlebnisse, Geschichten rund ums Haar, Freundschaft oder Reisen laden zum Sprechen und zum Zuhören ein. Die Wiener Caritas bietet einen „Plauderraum“, „ein digitales Wohnzimmer, in dem Menschen zusammenkommen, um sich in entspannter Atmosphäre über die verschiedensten Themen auszutauschen.“ Besuchsdienste und Nachbarschaftshilfen sind für solche Menschen von großem Vorteil, die wegen Alter und Gebrechlichkeit das Haus kaum mehr verlassen können, statt digitalem Kontakt aber das persönliche Gegenüber bevorzugen. Der gemeinnützige Verein „Silbernetz“ mit Sitz in Berlin bietet unter der Telefonnummer 0800 4708090 täglich von 8-22 Uhr anonym, vertraulich und kostenfrei ein „Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter“ an: Wer anruft, dem wird zugehört, „auch ohne akute Krise“. Auf Wunsch werden auch „Telefonfreundschaften“ vermittelt. Dann meldet sich zuverlässig einmal pro Woche der gleiche Gesprächspartner per Telefon.
Schon der knappe Überblick zeigt: Es gibt eine Menge Initiativen gegen die Einsamkeit, ganz häufig wohl auch direkt vor der eigenen Haustüre und, Gott sei Dank, häufig auch von der Kirche initiiert und begleitet. Wer sich einmal überwunden hat, den ersten Schritt zu tun, wieder mehr auf andere zuzugehen, der wird gewiss eine ganz neue Lebendigkeit spüren. Da mag es dann immer noch Einsamkeit und Alleinsein geben, dazwischen aber ganz viele Sternstunden, die man so nur gemeinsam erleben kann.