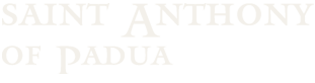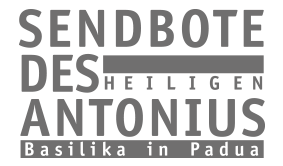Für eine lebendige Kirche auf dem Land
Unser Autor, Domkapitular im Erzbistum Bamberg und gelernter Landwirt, ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Landpastoral. Warum, und was dafür getan werden kann, um die Seelsorge in der Breite lebendig zu erhalten, erläutert er in unserem Thema des Monats.
Wurzeln geben Halt, sie lassen Heimat finden. Von ihnen ausgehend können die Pflanzen wachsen und reifen. Sie reichen in die Tiefe und holen das aus dem fruchtbaren Boden heraus, was eine Pflanze für das Überleben benötigt. Auch wir Menschen brauchen Wurzeln, die uns mit der Quelle des Lebens in Verbindung treten lassen. Sie reichen tief hinein bis weit in unsere Vergangenheit und die unserer Familie. Sie geben uns den nötigen Rückhalt, damit wir uns entfalten können. Ihre Kraft gewinnt aber auch die kräftigste Wurzel nicht aus sich selber, sondern aus dem Land, in dem sie eingepflanzt ist. Als Priester, der vom Land stammt und der selber in seiner Jugend- und Ausbildungszeit als Sohn eines Bauern in der Landwirtschaft gearbeitet hat, werde ich oft gefragt, wieso ich den stattlichen Hof meiner Eltern nicht übernommen und stattdessen Theologie studiert habe. Viele der Fragenden sehen in diesem Schritt offenbar so etwas wie eine radikale Lebenswende, als eine Aufgabe des bisher Gewesenen, so als hätte ich meine Wurzeln abgeschnitten. Ich selber empfinde das aber gar nicht so. Für mich selbst war und ist die Tätigkeit als Landwirt ein spiritueller Beruf.
Dankbar für die eigenen Wurzeln
Ich bin froh, dass ich vom Land komme. Das Eingebundensein in die Geborgenheit eines Dorfes mit seinen verlässlichen Gewohnheiten hat mir immer Kraft und Orientierung gegeben. Die Menschen, die ich in meinem Heimatort kennen lernen durfte, sind mir zuverlässige Freunde geblieben. Auf dem Land, unter den Menschen, die den gleichen „Stallgeruch“ (Papst Franziskus) haben, findet man leichter Freunde als in der Anonymität einer Großstadt. Bis heute kann ich auch diejenigen nicht verstehen, die sagen, sie seien froh, aus der „Enge“ eines Dorfes in das kulturelle Milieu einer Großstadt entflohen zu sein. Bei mir ist es genau anders herum: Ich bin stolz auf meine Herkunft und ich bin froh, dass ich weiß, wo ich herkomme und wo ich meinen Standort habe, mit anderen Worten: dass ich meine Wurzeln kenne, aus denen ich lebe.
Biblische Bilder vom Land
Die Bibel, und davon ausgehend die Theologie, ist voll von Bildern des Landes: Da ist die Rede vom Sämann, vom Korn, vom Hirten, vom Ochsen und vom Mastkalb, von der Schweine-herde, vom Schatz und vom Unkraut im Acker, von Bauern, Pächtern und Landarbeitern – und von Jesus, der mit seinen Jüngern durch die Kornfelder streift. In seinen Gleichnissen zeigt sich Jesus als ein Mensch vom Land. Nazareth, der Ort, in dem Jesus aufgewachsen ist, war damals ein Dorf von vielleicht etwa 400 Einwohnern. Weit über neunzig Prozent der Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft. Ihnen wandte sich Jesus mit seiner Predigt zu.
Die Kirche im Dorf und das Dorf in der Kirche
Wie lebendig, oder vielleicht besser gesagt: Wie tot ist die Kirche auf dem Land? Wir erleben seit Jahren überall dasselbe: Die Personaldecke für die Landpastoral wird immer dünner; die Seelsorgeeinheiten werden immer größer, und die meisten Pastoralpläne sind fast schon wieder Makulatur, wenn sie erscheinen. Gerade auf dem Land ist die Überalterung des Klerus besonders gravierend, und gerade hier sind Laientheologen noch lange nicht überall selbstverständlich. Die Abwanderung gerade von jungen und qualifizierten Leuten aus den Dörfern ist natürlich nicht nur für die Dörfer selbst, sondern auch für die Kirche im Dorf ein Problem.
Diese Prozesse laufen zumindest zurzeit bei uns unaufhaltsam und unumkehrbar ab. Dieser Entwicklung liegen gesamtgesellschaftliche Ursachen wie beispielsweise die sich bisher stets steigernde ökonomische Absicherung oder der Trend zur Individualisierung zugrunde, die von den Glaubensgemeinschaften kaum beeinflusst werden können. In dieser Lage steht die Kirche vor einem Dilemma: Wenn sie den Weg der Liberalisierung weitergeht und (salopp gesagt) ihre Kernbotschaft immer mehr verwässert, wird sie trotz aller zeitgemäßen Aktivitäten weiter an Plausibilität verlieren. Man spricht hier von der so genannten „kreativen Ohnmacht“ der Kirchen – sie können eigentlich so modern werden wollen, wie sie möchten, es wird ihnen letztlich nichts nützen.
Oder aber die Kirche versucht, ihre alte Strenge beizubehalten bzw. wiederzugewinnen. Dann aber würde sie sich weitgehend von der Gesellschaft abkoppeln und zu einer sektenartigen Existenz verurteilt sein. Das ist der Weg, den in beiden Kirchen manche erzkonservativen Kreise versuchen. Hier spricht man von der „destruktiven Ohnmacht“, denn mit Strenge und Zwang gewinnt man in der heutigen Gesellschaft keinen Blumentopf mehr, sondern man macht sich als Fundamentalist verdächtig und steht damit der Glaubwürdigkeit seiner eigenen, eigentlich frohen Botschaft im Weg.
Welche Chancen hat die Kirche?
Im Moment jedenfalls haben die Kirchen keine Chance, diesem allgemeinen Trend zu entkommen, bestenfalls können sie versuchen, sich so gut wie möglich an die Entwicklung anzupassen und stellenweise Kapital daraus zu schlagen. Die konfessionelle Zugehörigkeit etwa spielt immer weniger eine Rolle. Daraus ergibt sich für beide Kirchen die Chance, sich wechselseitig durch Arbeitsteilung zu entlasten – also: Mehr Ökumene wagen! Zwar spielt der kirchliche Glaube eine immer geringere Rolle im Land, deswegen sind die Menschen aber nicht notwendigerweise unreligiös. Diese allgemeine Spiritualität gilt es daher anzusprechen, beispielsweise auch durch die Kunst oder durch Gottesdienste in der freien Natur. Die verfasste Kirche verliert als Überzeugungsgemeinschaft an Relevanz, gewinnt aber als Dienstleistungsgemeinschaft an Bedeutung. Darin steckt auch eine Chance, wenn der erwartete Dienst an den Menschen ordentlich und authentisch geleistet wird. Die zunehmende Pluralisierung sorgt dafür, dass ein Angebot für alle nicht mehr ausreicht. Daher gilt es, einzelne sich bietende Gelegenheiten zu nutzen und sich als ein „Player“ in die zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit einzubringen, z. B. bei Vereinsjubiläen oder Katastrophenfällen. Auch der Trend zur Individualisierung kann genutzt werden, indem man die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen beispielsweise im Ehrenamt respektiert und stärkt. Individuelle Geschmacksfragen spielen eine weit größere Rolle als früher. Daher gilt es auf die Lebensstile der Menschen gezielt einzugehen und das Potential der Riten stärker als bisher zu nutzen.
Die Lebendigkeit oder zumindest das Überleben einer Gemeinde hängt jedenfalls nicht allein vom Pfarrer ab, sondern von den Gläubigen, vom Volk Gottes – und das gilt übrigens auch, falls noch ein Pfarrer im Ort ist. Da das Zweite Vatikanische Konzil wieder deutlich gemacht hat, dass alle Getauften und Gefirmten Anteil am priesterlichen Dienst in der Kirche haben, müssten unsere Dörfer zu Pastoralgemeinschaften werden, in denen nicht so sehr die Unterschiede zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen bzw. zwischen Geweihten und Ungeweihten eine Rolle spielen als vielmehr das gemeinsame Zusammenwirken zum Wohle aller.
Pastorale Ressourcen auf dem Land
Meines Erachtens haben gerade die Landgemeinden die Chance, das Missverständnis zu überwinden, die Kirche sei identisch mit der Institution, dem Apparat oder den Hauptamtlichen. Gerade auf dem Land ist es einfacher, den Gläubigen klar zu machen, dass sie selber die Kirche sind, und zwar deshalb, weil in der Regel ehrenamtliches Engagement, Zusammenhalt und bodenständiges Selbstbewusstsein hier (noch) selbstverständlicher sind als in städtisch geprägten Regionen. Dieses Selbstbewusstsein muss sich keinesfalls gegen die Amtsträger richten, sondern bildet zumindest von Fall zu Fall vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle eine Art Mistbeet für geistliche Berufe, das nur manchmal deshalb seinen vollen Ertrag nicht entfalten kann, weil die oben beschriebene allgemeine Misere der Landpastoral natürlich auch diesen wichtigen Bereich betrifft: Wo können denn in unseren Dörfern junge Menschen noch mitreißende junge Geistliche erleben?
Es gibt also so etwas wie noch ungehobene Schätze, Ressourcen des Landes, die für die Kirche nutzbar gemacht werden könnten: Die bereitwillige Übernahme von Verantwortung, das Sicherheitsnetz der Gemeinschaft im Dorf, der immer noch relativ hohe Grad an Beteiligung am öffentlichen Leben, z. B. in den Vereinen, der spirituelle Reichtum an Brauchtum und Festen, die Nachhaltigkeit der von der Natur geprägten Weltanschauung und Spiritualität, um nur einige zu nennen. Umgekehrt haben auch der Glaube und die Kirche speziell für das Land einiges zu bieten: Orte der Besinnung, eine Kultur des Gesprächs und das Bewusstsein von der Heiligkeit der Gemeinschaft. Sie kann noch am ehesten Menschen motivieren und mobilisieren, und sie bietet Rituale und Riten zur Lebensbewältigung an, die immer noch konkurrenzlos sind. Aus all dem kann man auch im 21. Jahrhundert noch viel machen!
Ehrenamt stärken
Die Ehrenamtlichen, die sich zur Mitarbeit in der Kirche gewinnen lassen, dürfen nicht allein gelassen werden. Sie sollten die Gelegenheit erhalten, ihre Fähigkeiten im Rahmen ihrer Mitarbeit weiter zu entwickeln und so auch ihrerseits von ihrem Engagement profitieren. Dazu sind ein ordentliches Ausbildungsangebot, Trainingsmöglichkeiten und Qualifizierung für Leitungsaufgaben erforderlich. Hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter, die ihrerseits verstärkt in Fragen der Dialog- und Konfliktfähigkeit bzw. der Personalführung geschult werden müssen, übernehmen dann mehr und mehr die Rolle der Koordination der ehrenamtlichen Initiativen. Auch die Strukturen der Diözese wirken nach dem Subsidiaritäts- und dem Solidaritätsprinzip lediglich unterstützend, aber nicht mehr vom grünen Tisch entscheidend mit. Wichtig ist dabei vor allem auch eine echte Mitsprachemöglichkeit der Ehrenamtlichen vor Ort und die verstärkte Selbstverantwortung der Gremien vor Ort, auch in finanzieller Hinsicht.
Mit allen im Boot
Ich möchte dafür zum Schluss fünf Thesen formulieren: Es muss erstens verstärkt darum gehen, Ehrenamtliche Verantwortung übernehmen zu lassen, beispielsweise als Wortgottesdienstleiter oder als Ansprechpartner im Ort für kirchliche Fragen. Es muss durch verbindliche Regelungen aufhören, dass Pfarrer willkürlich durch ehrenamtliches Engagement aufgebautes Vertrauen zerstören können. Um trotzdem ein hohes Niveau kirchlicher Angebote zu halten und die Ehrenamtlichen nicht zu überfordern, muss es zweitens kostenlos und flächendeckend hochwertige Angebote zur Weiterbildung für die engagierten Gemeindemitglieder geben. Drittens folgt daraus, dass in Zukunft auf der Ebene kleinerer Orte die kirchlichen Strukturen bzw. Hauptamtliche vorwiegend subsidiär-unterstützend im Sinn einer sinnvollen Vernetzung wirken und nur noch selten selbst in Aktion treten werden. Um die weniger werdenden Kräfte zu schonen, werden wir viertens in der Landpastoral trotz allem an einer sinnvollen lokalen Schwerpunktsetzung, orientiert an den örtlich vorhandenen Charismen, nicht herumkommen. Fünftens und letztens sollte die Zeit von Platzhirschen und Eigenbrötelei im Dorf ein Ende haben: Es gilt, auch bei kirchlichen Aktionen alle im Dorf mit ins Boot zu holen, auch wenn sie angeblich (noch) nicht richtig dazugehören.
In seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ schreibt Autor Andreas Rödder: „Der historischen Erfahrung nach wird die Zukunft in doppeltem Sinn anders sein: Anders als die Gegenwart und anders als gedacht.“ Das gilt sicher auch für die Zukunft der Kirche auf dem Land. Hoffen wir, dass sie besser sein wird als das, was wir befürchten.