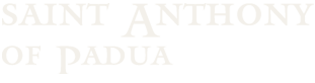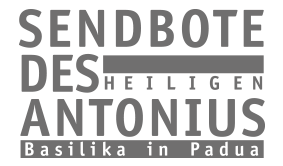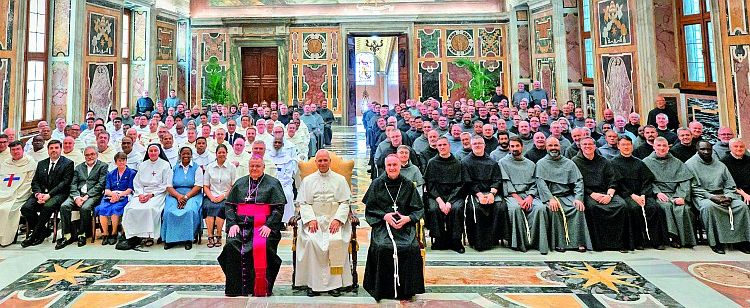Was will der neue Papst?
Was konnte man in den letzten Monaten bereits nicht alles lesen über den neuen Papst. Bei allen Spekulationen und Vermutungen über seine Schwerpunkte rät unser Autor zur Geduld – mit guten Gründen.
Die Theologin und freie Journalistin Alina Rafaela Oehler hat in einem Beitrag für die Internationale Katholische Zeitschrift Communio vom 26. Juni 2025 zu Recht festgestellt: „Manche Berichterstattung über Leo XIV. verrät mehr über die Autoren als über den neuen Papst.“ Frau Oehler kritisiert in ihrer Kolumne „Gern katholisch“ die tendenziöse Berichterstattung mancher Autorinnen und Autoren, die in Nachrichtentexten die Meinungs- und die Sachebene vermischen, sowie ihre Versuche, Stellungnahmen des Papstes aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang zu lösen, sie vollständig umzudeuten und so Papst Leo XIV., der für viele Menschen und in vielerlei Hinsicht noch ein „unbeschriebenes Blatt“ ist, ungefragt für die eigenen Themen zu vereinnahmen. So werden der neue Papst und sein eben erst begonnenes Pontifikat gerade aufgrund der von ihm an den Tag gelegten behutsamen Art zu einem kirchenpolitischen Spielball: Irgendwie wollen die so apostrophierten Autorinnen und Autoren wissen, dass und warum Papst Leo XIV. gerade zu „seinem“ beziehungsweise „ihrem“ eigenen Lager gehört. So wird dann – wohl in Erwartung bestimmter Antworten – beispielsweise die Frage in den Raum gestellt, ob Papst Leo XIV. am Zölibat, das heißt an der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester, festhält oder ob künftig auch Frauen zu katholischen Priesterinnen geweiht werden können oder ob Laien in der Kirche in allem ein Mitentscheidungsrecht erhalten oder ob der Papst eine begrenzte Amtszeit von Bischöfen einführen oder die strikte Geheimhaltung um die Papstwahl im Konklave aufheben wird. Es gibt sicher in manchen Ländern eine Reihe von Katholiken, für die das echte und bewegende Fragen sind – aber sind das auch originäre Fragen von Papst Leo XIV., an deren Lösung er vordringlich arbeiten will? Bislang gibt es noch keine belastbaren Hinweise dafür.
Vergleich mit dem Vorgänger
Alle, die neu in ein bestimmtes Amt kommen, werden gerade zu Beginn ihrer Amtszeit damit leben müssen, dass sie mit ihrer Vorgängerin oder ihrem Vorgänger verglichen werden; das gilt für einen neuen Papst ebenso wie für einen neuen Regierungschef oder die Leiterin eines großen Unternehmens: Was ist genauso wie früher und wo gibt es Unterschiede – oder vielleicht sogar Widersprüche? Was ist bekannt und vertraut und was wirkt neu, innovativ oder sogar revolutionär – und damit vielleicht auch verunsichernd? Alle Vergleiche, die in solchen Zusammenhängen angestellt werden, mögen den Boden unter den Füßen des Fragestellers tragfähiger und sicherer erscheinen lassen, aber sie engen die oder den Neuen doch auch in gewisser Weise ein: Sie oder er wird vorrangig aus einer ganz bestimmten Perspektive betrachtet, und es besteht die Gefahr, dass der Blick für das Ganze verloren geht.
Unbeschränkte Macht
Aus der Sicht des Kirchenrechts kann man im Zusammenhang mit der Wahl von Papst Leo XIV. natürlich die Frage stellen, ob – und wenn ja: inwieweit – ein neuer Papst an das gebunden ist, was sein Vorgänger getan und entschieden hat. Hierfür sind mehrere Normen des CIC (Codex Iuris Canonici; Gesetzbuch der lateinischen Kirche) zu befragen: Der c. 331 CIC beschreibt in genereller Form die Vollmacht des Papstes: „Der Bischof der Kirche von Rom …. ist Haupt des Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und Hirte der Gesamtkirche hier auf Erden; deshalb verfügt er kraft seines Amtes in der Kirche über höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Vollmacht (Gewalt), die er immer frei ausüben kann.“ Die mit dem Kirchenamt des Papstes verbundene Vollmacht – sie wird daher als „ordentliche“ Vollmacht bezeichnet – wird als höchste, volle, unmittelbare und universale Vollmacht beschrieben: Weil sie „höchste“ Vollmacht ist, gibt es keine Vollmacht über ihr, und deshalb gilt gemäß c. 333 § 3 CIC, dass es gegen ein Urteil oder ein Dekret des Papstes weder Berufung noch Beschwerde gibt. Die päpstliche Vollmacht ist „voll“, das heißt, dass sie keiner sachlichen Beschränkung unterliegt. Sie ist „unmittelbar“, so dass der Papst einerseits nicht auf irgendwelche vermittelnden Instanzen wie etwa eine Bischofskonferenz angewiesen ist, andererseits kann sich auch jeder Gläubige im Sinn des c. 212 § 2 CIC unmittelbar an den Papst wenden. Die päpstliche Vollmacht ist „universal“, das heißt, dass sie sich nicht nur auf die Kirche von Rom, sondern auf die weltweite Kirche bezieht, und sie kann immer frei ausgeübt werden: Der Papst darf weder zu einem bestimmten Handeln gezwungen noch bei seinem freien Handeln behindert werden; die Behinderung der päpstlichen Vollmacht ist gemäß c. 1372 n. 1° CIC mit einer Sühnestrafe im Sinn des c. 1336 §§ 2-4 CIC bedroht. Diese freie Ausübung der päpstlichen Vollmacht bedeutet aber nicht Willkür, denn auch der Papst ist an die göttliche Offenbarung sowie an die Lehre und die geltende Verfassung der Kirche gebunden.
Die freie Ausübung seiner Vollmacht steht dem jeweiligen Papst während der gesamten Dauer seiner Amtszeit zu, das heißt vom Zeitpunkt der Annahme seiner rechtmäßig erfolgten Wahl zusammen mit der Bischofsweihe (vgl. c. 332 § 1 CIC) bis zum rechtmäßigen Amtsverlust und dem damit erfolgenden Eintritt der Sedisvakanz durch seinen Tod oder durch seinen rechtmäßigen Amtsverzicht (vgl. c. 416 i. V. m. c. 332 § 2 CIC).
Nicht an Vorgänger gebunden
Die Frage, ob – und wenn ja: inwieweit – ein neuer Papst an das gebunden ist, was sein Vorgänger getan und entschieden hat, kann aus kirchenrechtlicher Sicht eindeutig beantwortet werden: Eine solche Bindung besteht nicht, denn sie wäre kirchenrechtlich als eine Behinderung der päpstlichen Vollmacht zu charakterisieren. Ein Papst kann seinen Nachfolger nicht binden und niemand kann einen Papst rechtmäßig dazu zwingen, in einer bestimmten Sache genau so zu handeln und zu entscheiden, wie sein Vorgänger das getan hat. Nur eine rechtmäßig bindende Wirkung ist erkennbar: Wenn nämlich ein Papst in Ausübung seines unfehlbaren Lehramtes eine Glaubens- oder Sittenlehre im Sinne des c. 749 § 1 CIC definitiv als verpflichtend verkündet hat. Eine solche definitive Feststellung kann aber nicht beliebig erfolgen, sondern unterliegt den strengen Bedingungen der cc. 749 und 750 CIC: Sie ist nur möglich in Fragen des Glaubens und der kirchlichen Sittenlehre, also in den zentralen Fragen der katholischen Identität und der christlichen Existenz. Sie muss vom Lehramt der Kirche als eine Lehre vorgelegt werden, die im geschriebenen oder im überlieferten Wort Gottes als dem der Kirche anvertrauten Glaubensgut enthalten ist und zugleich von Gott geoffenbart worden ist, oder es muss sich um eine endgültige Lehre des Glaubens und der Sitten handeln, die zur unversehrten Bewahrung und zur getreuen Darlegung des Glaubensgutes erforderlich ist. Alle anderen Fragen, die in der Kirche in Gemeinschaft mit dem Papst zu bearbeiten und zu lösen sind, entfalten eine solche Bindungswirkung nicht.
Ich halte es für selbstverständlich, dass Gläubige neugierig sind auf Papst Leo XIV. und dass sie wissen wollen, wo sie mit ihm dran sind. Natürlich wird beobachtet, wie Leo XIV. sich kleidet, wen er empfängt, wohin er reist und dass er in Castel Gandolfo Urlaub macht. Bei all dem sollten wir dem Papst aber etwas Zeit geben. Er wird dann schon zeigen, wie er denkt und was er in seinem Pontifikat vorhat.